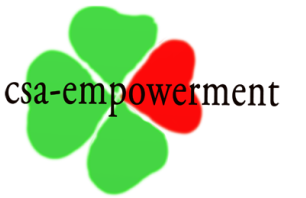Grenzen nichts als Grenzen?
Im Juni 2000 bin ich 45 Jahre alt, stehe kurz vor der Diplomierung als Sozialarbeiterin HFS, bin als Sozialbehördenpräsidentin einer grösseren Gemeinde tätig, verheiratet und Mutter von zwei Töchtern. Während meines Studiums scheint mir alles erreichbar, alles lernbar, alles nur von einer guten Organisation abhängig, alles grenzenlos möglich zu sein. Ich freue mich auf die Zukunft in meinem Wunschberuf. Da ich Beschwerden mit meinen Augen sowie Gefühlsstörungen in den Beinen habe, suche ich meinen Hausarzt auf. Nach verschiedenen ärztlichen Untersuchungen steht die Diagnose fest. Multiple Sklerose MS. Meine Klasse TAA 25 plant die Diplomreise und die Diplomübergabe in einem festlichen Rahmen. Mir ist gar nicht nach Feiern zu Mute. Die Beschwerden gehen nach einiger Zeit vollständig zurück. Noch einmal Glück gehabt. Nun konzentriere ich mich auf eine Stelle in meinem Traumberuf. Diese finde ich bei der Pro Infirmis in Glarus. Nach eineinhalb Jahren holt mich die Krankheit wieder ein. Ich muss mein Pensum auf die Hälfte reduzieren, da die Müdigkeit zurückbleibt, wie bei ca. 80% der Betroffenen auch. Wenn meine Arbeitskollegin mir am Mittag einen schönen Nachmittag wünscht, kann ich die Aussicht auf einen freien Nachmittag nicht geniessen, vielmehr will ich doch am Nachmittag wiederkommen und arbeiten. Mit der Zeit akzeptiere ich die neue Situation und bin glücklich, dass ich mit einem halben Tag im Arbeitsprozess bleiben darf.
Die Krankheit hält sich nicht an meine Wünsche. Da ich immer mehr Mühe habe die geforderten Leistungen zu erbringen, meldet mich meine Neurologin am Universitätsspital Zürich zu einer neuropsychologischen Abklärung an. Hier wird meine Vermutung bestätigt, dass ich kognitive Teilleistungsstörungen habe, wie etwa 50% der MS-Betroffenen auch. Das ist nun der schwierigste Schritt in meinem Leben. Meine Leistungen sind mit der Müdigkeit zusammen so eingeschränkt, dass ich meine Arbeit als Sozialarbeiterin nicht mehr ausführen kann. Ich kann nicht verstehen, dass ausgerechnet ich meinen Traumberuf verlassen muss. Lange kann ich mein Schicksal nicht akzeptieren, fühle mich aus der Gesellschaft ausgegrenzt.
Die Krankheit zwingt mich meinen Zeithaushalt zu überprüfen, meine Grenzen gut zu beobachten und nicht zu überschreiten, herauszufinden was im Moment für mich wichtig ist und vor allem Prioritäten zu setzen. Aber auch zu akzeptieren, dass der Körper nicht immer die Leistungen erbringen kann, welche der Kopf will. In meiner Jugend habe ich immer sehr gerne geschrieben und wollte damals das Schreiben zu meinem Beruf machen. Einmal ein Buch schreiben und veröffentlichen war mein Traum. So begann ich wieder zu schreiben und bemerkte bald, dass meine Leidenschaft aus der Jugend immer noch da war.
Ich verfasse Tagebücher, die mich in den schwierigen Zeiten begleiten. Als ich in meiner rechten Hand nicht mehr über genügend Kraft verfüge und meine Schrift unleserlich wird, kommt mir die neue Technik zu Hilfe. Ich bin jetzt Besitzerin eines Laptops, auf das ich nicht mehr verzichten kann. Nun bin ich gespannt, wohin mich mein Leben führen wird. Vielleicht erfüllt sich mein Jugendtraum doch noch.
Artikel in: Nachrichten 2006 der Pro Infirmis Glarus